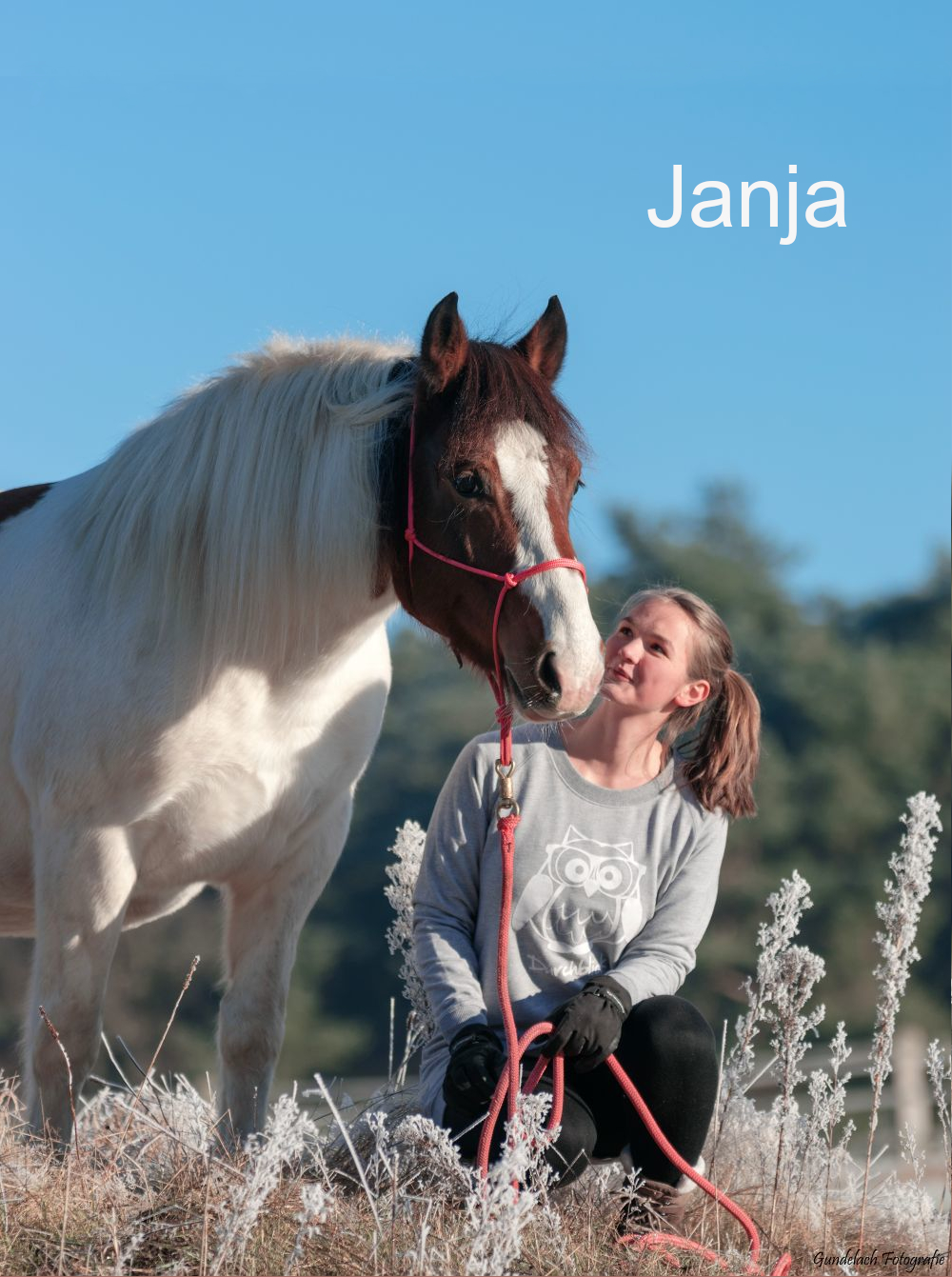Nur eine korrekt ausgeführte Haltung trägt zur Gesunderhaltung des Pferdes bei.
Man kennt sie, diese Bilder schlechten Reitens: Das Pferd latscht mit tiefem Kopf hinter der Senkrechten und mit herausschiebenden Hinterbeinen dauerhaft auf der Vorhand – und der Reiter nennt es vorwärts-abwärts. Oder das Pferd ist in absoluter Aufrichtung zusammengeschoben, das Genick der höchste Punkt – aber der Rücken hängt dennoch durch, die Kruppe springt, die Hinterbeine tippeln, statt Last aufzunehmen und das Vorwärts ist nicht mehr vorhanden.
Vorwärts-Abwärts oder Aufrichtung ist eine Diskussion, die heiß geführt wird und die Reiterwelt spaltet. In der klassischen Reitkunst wird das Vorwärts-Abwärts mit Skepsis betrachtet und in der englischen Reitweise fast schon zum Selbstzweck erhoben.
Was ist denn nun richtig? Soll der Kopf runter oder soll das Pferd in Aufrichtung gehen? Die Antwort ist: Beide, vorwärts-abwärts und Aufrichtung, sind wichtige Teile der Ausbildung eines Pferdes, wenn man sie richtig ausführt. Und beide können eben auch falsch eingesetzt werden.
Vorwärts-abwärts und Aufrichtung: aber bitte korrekt!
Beim korrekten Vorwärts-abwärts geht das Pferd in positiver Spannung mit aktiven Bauchmuskeln und aufgedehnter Oberlinie, der Rücken wölbt sich. Das Pferd dehnt und streckt sich vorwärts-abwärts, wobei der Kopf vor der Senkrechten bleibt.
Bei korrekter Aufrichtung wird es leicht auf der Vorhand, weil sich die Gelenke der Hinterhand vermehrt winkeln und es mehr Last aufnimmt, während sich gleichzeitig Hals und Brustkorb heben: Das Pferd versammelt sich. Korrektes Vorwärts-Abwärts und Aufrichtung haben also eine Gemeinsamkeit: Die Rolle der Hinterhand ist zentral und in beiden Fällen ist sie aktiv.
Beide Positionen sind wichtig für gutes Reiten, beanspruchen doch beide unterschiedliche Muskeln und haben andere Funktionen. Das bedeutet im Umkehrschluss: Sein Pferd dauerhaft am langen Zügel vor sich hin schlappen zu lassen ist genauso schädlich wie eine falsch verstandene Aufrichtung, die mit der Hand erzeugt wird.
Ein Pferd, das korrekt vorwärts-abwärts geht, demonstriert damit seine geistige und körperliche Losgelassenheit. Das ist der Ausgangspunkt von fairer Pferdeausbildung. Die beginnt nicht mit versammelnden Lektionen, sondern zunächst mal mit aktiver Entspannung. Das Mehr an Aufrichtung kommt dann mit fortschreitender Ausbildung, über die das Pferd an Kraft und Balance gewinnt – was es dann in die Lage versetzt, sich und den Reiter vermehrt mit der Hinterhand zu tragen.
Vorwärts-abwärts in der Geschichte der Reiterei
Das korrekte „Vorwärts-Abwärts“ stammt aus der H.Dv. 12 (Heeresdienstvorschrift Nr. 12), einer historischen Reitvorschrift aus dem Jahr 1912. Sie basiert auf den Prinzipien der klassischen Reitkunst und floss in die modernen Richtlinien für Reiten und Fahren der Deutschen Reiterlichen Vereinigung ein. Die „Haltung der jungen Remote beim ersten Anreiten“ zeigt das korrekte Vorwärts-Abwärts: Dabei ist das Genick der höchste Punkt und die Nase auf Höhe des Buggelenks, aber nicht tiefer. Mit zunehmender Ausbildung trägt das Pferd den Kopf dann immer höher.
Vorhandlastigkeit plus Reitergewicht: die Auswirkungen
Anatomisch bedingt tragen Pferde 60 Prozent ihres Gewichts mit der Vorhand und nur 40 Prozent mit der Hinterhand. Ein Reiter verschärft das Missverhältnis noch. Hinzu kommt: Pferde besitzen kein Schlüsselbein: Der Brustkorb wird von einer Aufhängung stabilisiert, kann sich entsprechend heben, aber eben auch absinken. Hier kann das Reitergewicht zum Problem werden, weil es den Widerrist nachweislich absinken lässt. Das geht mit einer Mehrbelastung von Sehnen und Bändern im Bereich der Fesseln und Hufe einher. Wird das Pferd zu tief eingestellt und in hohem Tempo geritten, verstärkt sich der Effekt durch den Schub der Hinterhand: Das Pferd läuft Gefahr fest im Rücken zu werden, mit der Vorhand zu bremsen und regelrecht in den Boden zu laufen. Das kann sich sogar auf das Gangbild des Pferdes auswirken. Deswegen gibt es immer wieder auch Stimmen, die vorwärts-abwärts nur an der Longe empfehlen – eben ohne das Gewicht des Reiters.
Richtig ausgeführt kann das Vorwärts-Abwärts die Dehnung des Nackenbands unterstützen – durch die Entspannung und den aufgewölbten Rücken entfernen sich die Dornfortsätze der Wirbelsäule voneinander. Die Oberlinie wird stärker. Wichtig ist dabei, dass das Pferd mit aktiver Hinterhand vorwärtsgeht und nicht zu tief kommt. Der Reiter lässt die Zügel dafür aus der Hand kauen, ohne die Verbindung vollständig aufzugeben. Sonst geht der Spannungsbogen verloren.
Das Optimum: Vorwärts-abwärts und Aufrichtung als Trainingsbausteine
Vorwärts-abwärts und Aufrichtung: Es muss kein Entweder-Oder sein, viel besser ist ein Sowohl-als-auch. Erst dehnende und versammelnde Übungen im Wechsel erlauben eine gleichmäßige Gymnastizierung des Pferdes; unterschiedliche Kopf- und Halseinstellungen sprechen verschiedene Muskelgruppen an, fördern Balance und Koordination und verbessern die Beweglichkeit.
Der Reiter kann mit dem Vorwärts-abwärts auch immer wieder prüfen, ob sein Pferd losgelassen ist und sich gern wieder dehnt und freimacht. Versammlung ohne Dehnungsbereitschaft ist nicht reell. Auf der anderen Seite schadet es dem Pferdekörper auf Dauer, wenn nicht an der Versammlung gearbeitet wird und es damit das Reitergewicht als zusätzliche Belastung der Vorhand mittragen muss. Die Mischung macht’s.